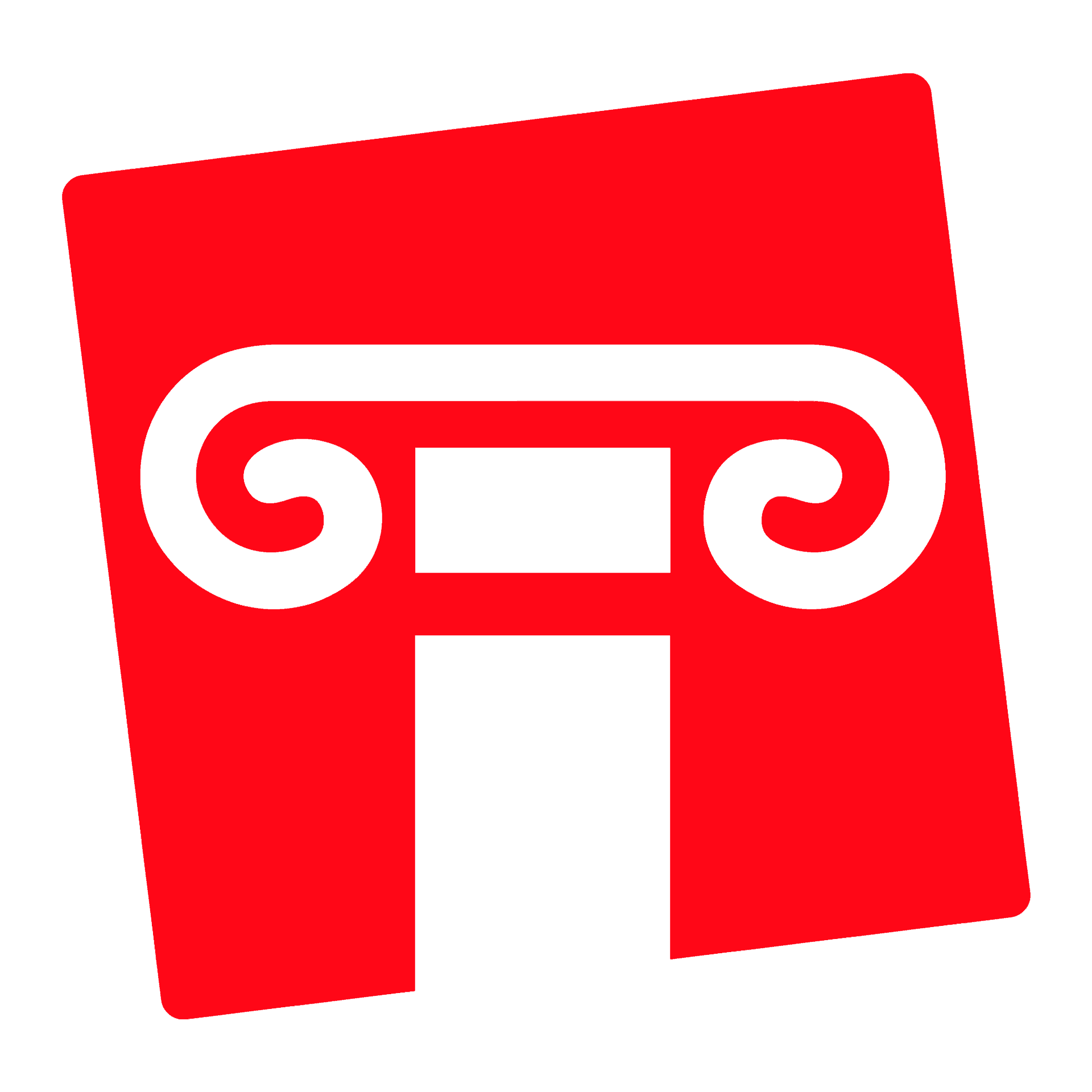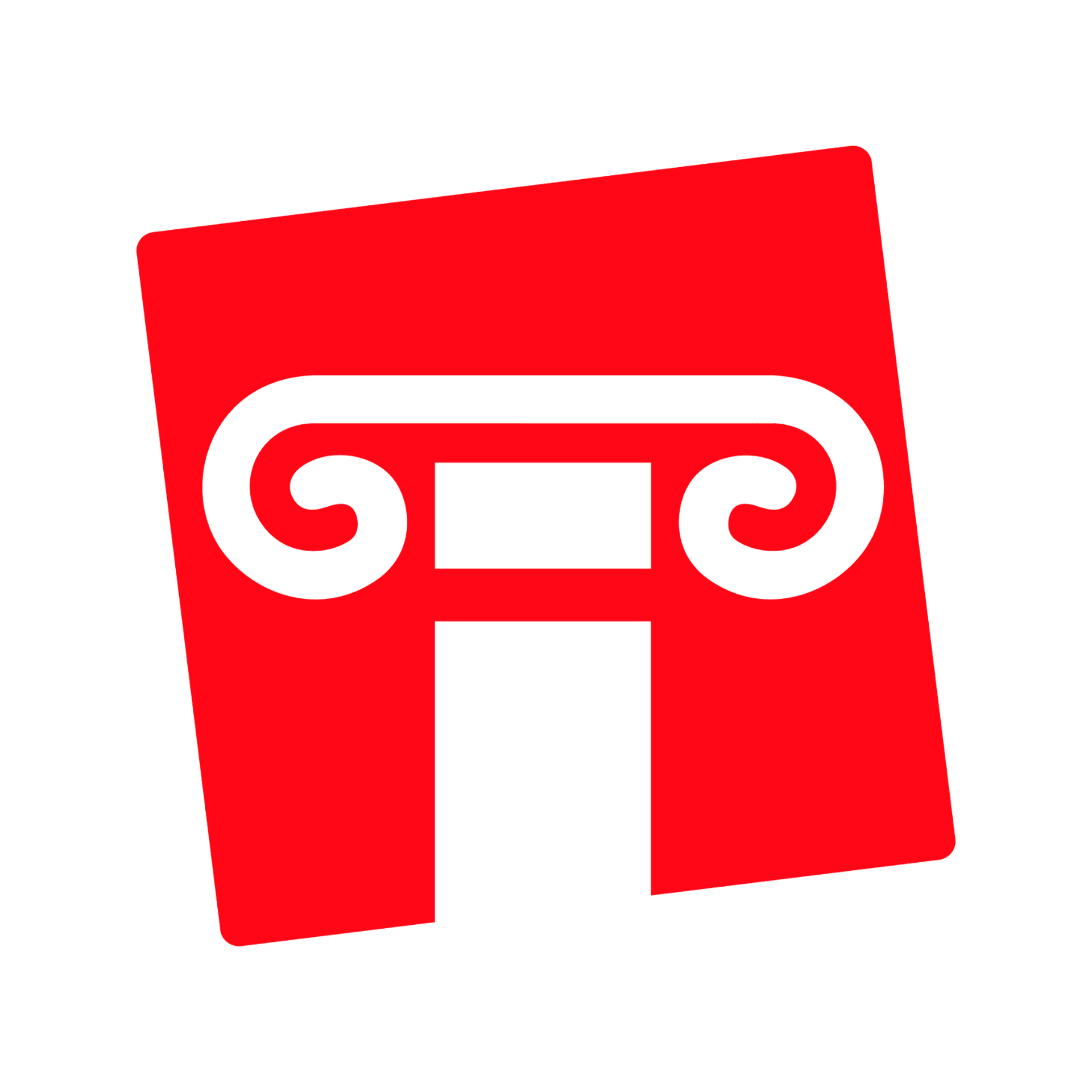Das dachte sich der Latein Lk der Q3 bei einem hochsommerlichen Ausflug in die Bibliotheca Fuldensis.
Aber fangen wir von vorne an. Wann wurde Fulda Fulda?
Während der Antike war Fulda jedenfalls noch nicht existent. Nichts als Bäume, Wald und vielleicht ein paar umherstreifende Menschen, die ab und zu an der Fulda Rast einlegten. Auch wenn keltische Siedlungsspuren an der Milseburg bis in die Eisenzeit (ab 750 v.Chr.) zurückreichen, war doch selbst zur Blütezeit des Römischen Reichs im heutigen Fulda nichts von den Errungenschaften römischer Zivilisation zu spüren. Fulda war vermutlich ziemlich barbarisch!
Die Gründung des Fuldaer Klosters durch Sturmius und Bonifatius im Jahr 744 änderte dies. Das Kloster wuchs rasch und wurde – begünstigt durch Karl den Großen – schnell zu einem strategischen Stützpunkt und kulturellen Leuchtturm im Herzen Europas.
Na gut, aber vernichtete das „Dunkle Mittelalter“ nicht das gesammelte Wissen der Antike, und wie kommt es, dass wir heute antike Texte in der Hand halten? Genau dieser Frage gingen wir gemeinsam mit Thomas Martin auf den Grund. Thomas Martin ist pensionierter Latein- und Geschichtslehrer, Heimatforscher, und er wirkt seit vielen Jahren im bischöflichen Archiv bei einem weltweit vernetzten Forschungsprojekt zu den Fuldaer Handschriften mit.
Nachdem der Kontakt zustande gekommen war, schlug Thomas Martin vor, eine Lateinstunde als Vorbereitung zu nutzen, damit wir eine Idee von Textüberlieferung bekommen. Wir lernten, wie man im Mittelalter schrieb und konnten durch einen Selbstversuch – das Schreiben des Buchstaben „g“ – feststellen, dass jeder Mensch seine eigene „Schreibe“ hat.
Warte mal, was soll denn Textüberlieferung sein? Vor der Erfindung des Buchdrucks konnten Bücher nur durch Abschreiben vervielfältigt werden. In der Antike wurde zunächst auf Papyrus geschrieben. In den Klöstern des Mittelalters schrieben die Mönche jedoch auf teures Pergament, welches aus getrockneter Tierhaut besteht. So staunten wir nicht schlecht, als Thomas Martin uns erklärte, wie viele Kühe für das Pergament eines Buches sterben mussten. Denn nur eine kleine Textmenge von vielleicht 50 Seiten passt auf eine Kuhhaut!

Jedenfalls waren die Klöster für die Überlieferung lateinischer Texte unverzichtbar. Zum Beispiel wurden so die Bücher I-IV der Annales, ein berühmtes Geschichtswerk von Tacitus, nur durch einen einzigen Schriftträger im Mittelalter überliefert. Zwischen 830 und 840 wurde genau dieser im Fuldaer Kloster hergestellt. Später kam die Abschrift dann nach Corvey an der Weser, wo sie zu Beginn des 16. Jahrhunderts entwendet wurde. Seit 1508 ist diese Handschrift nun in Florenz, da der spätere Papst Leo der X. diesen in Italien erwarb.
Fulda war unter Rabanus Maurus zu einer Hochburg der Bildung und Textüberlieferung geworden. Der Großteil der Fuldaer Klosterbibliothek wurde jedoch 1632 im Rahmen des 30-jährigen Krieges verschleppt und zerstört. Das Institut Bibliotheca Fuldensis an der Theologischen Fakultät Fulda hat es sich seit 1982 zur Aufgabe gemacht, den einstigen Schatz der Klosterbibliothek digital zu rekonstruieren.
In den Vorgang des Rekonstruierens von lateinischen Originaltexten und die Überlieferungsgeschichte bekamen wir durch den Vortrag und die Führung von Thomas Martin genauere Einblicke. Dass jeder Schreiber seine eigene Handschrift hatte, klang für uns zunächst nicht sonderlich spannend – das hatten wir ja in der Vorbereitungsstunde gelernt –, aber dass man anhand der Handschriften viele Schreiber weltweit identifizieren und so die Verbindungen zwischen den verschiedenen Klöstern und damit die Überlieferungsgeschichte genau nachverfolgen kann, war dann doch faszinierend. Und die Betrachtung einzelner Handschriften war nicht weniger beeindruckend: Jeder Codex ist ein liebevoll gestaltetes Kunstwerk.
Thomas Martin bescherte dem Lk Latein einen durchaus anspruchsvollen und streckenweise anstrengenden, aber eben dadurch auch einen außerordentlich bemerkenswerten Nachmittag mit ungewöhnlichen Einblicken in ein entlegenes Thema.
Johannes Matl (Winfriedschule)