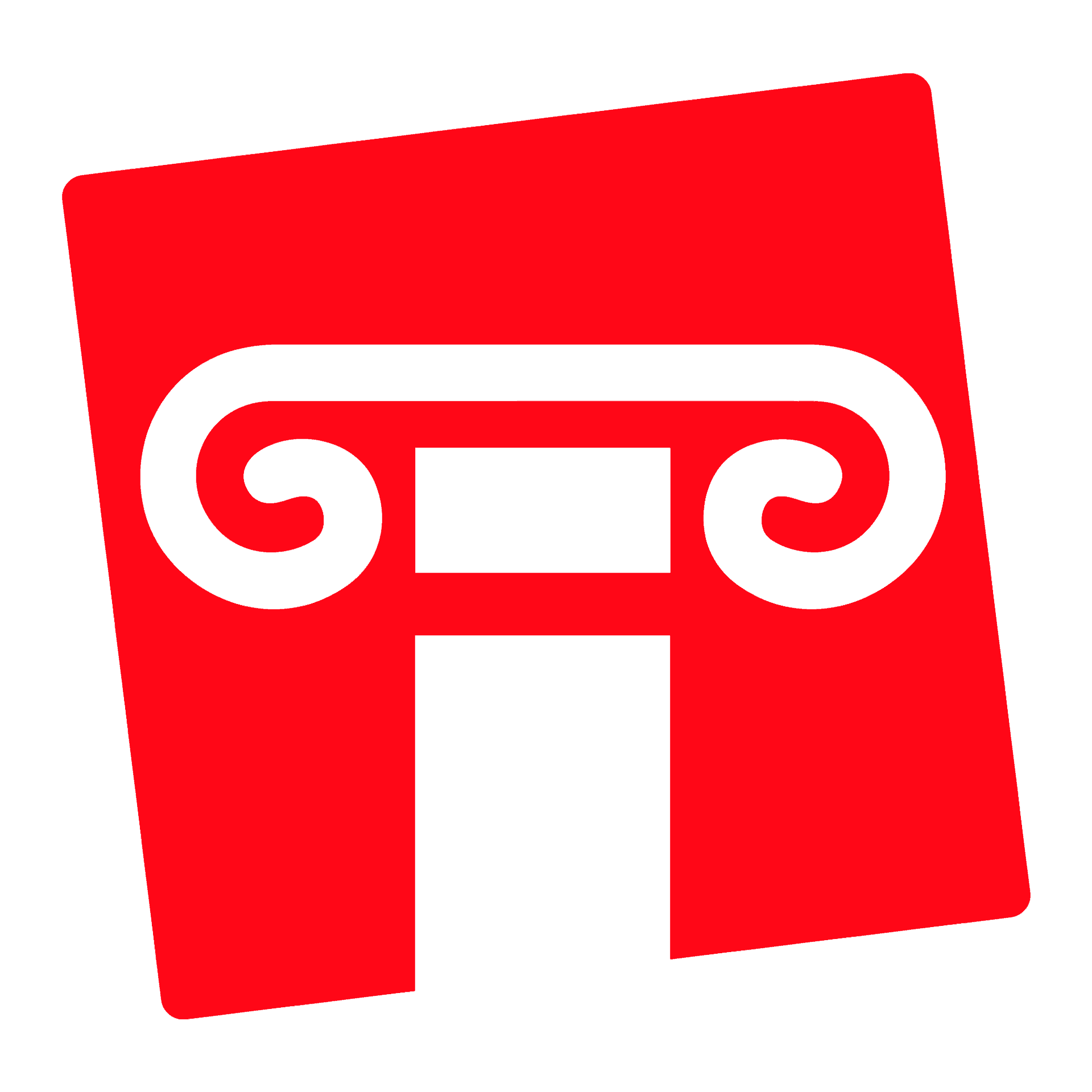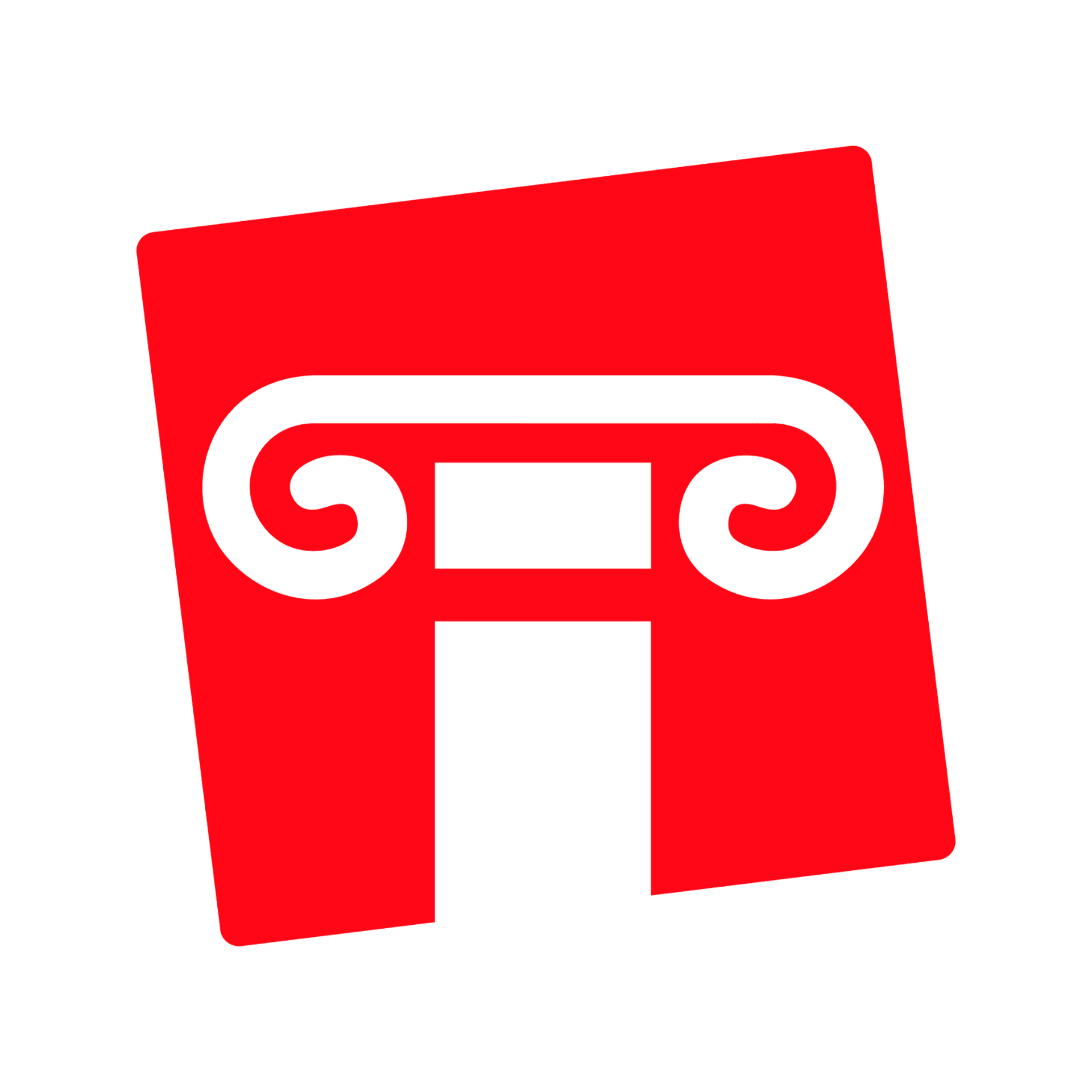Prof. Dr. Andreas Dengel von der Uni Frankfurt erklärt die Funktionsweise von KI
Was haben Bob-Dylan-Songs und neuseeländische Pinguine gemeinsam? – Natürlich nichts, bis auf die Tatsache, dass man ein KI-Programm mit ihren Eigenschaften trainieren kann, um dann durch statistische Wahrscheinlichkeiten entweder neue Dylantexte produzieren zu können oder Voraussagen darüber zu treffen, ob ein Pinguin friedlich gesinnt ist oder nicht. Beides demonstrierte Prof. Dr. Andreas Dengel von der Goethe-Universität Frankfurt am 11.02.in der Aula des Domgymnasiums einem interessierten Publikum.
Dass die Frage immer drängender wird, inwiefern KI-Tools wie ChatGPT, Midjourney oder DeepL den Unterricht und das Berufsleben verändern, hat sich mittleiweile herumgesprochen. Natürlich fühlen sich Lehrkräfte oft entweder genervt von der Einfalt mancher Jugendlicher, ChatGPT-Antworten als eigene Erzeugnisse anzupreisen, oder aber herausgefordert, Unterrichtsformate entsprechend zu verändern.
Prof. Dengel sagt dann auch freimütig das Ende von Hausaufgaben voraus – und möglicherweise auch das von aufwändigen Korrekturen. Ob die flipped-classroom-Methode verstärkt eingesetzt werden sollte, bei der man die Recherche aus dem Unterricht auslagert und die Besprechung und Analyse der Ergebnisse in den Unterricht holt, muss sicher am individuellen Beispiel entschieden werden.
Dengel, der als ehemals jüngster Professor in Deutschland, einen Lehrstuhl für die Didaktik der Informatik innehat, hat zu Übungszwecken einige KI-Tools programmiert und fütterte diese nun in der Aula vor aller Augen mit Daten, sodass man gut erkennen konnte, wie abhängig die jeweiligen Tools von den Trainingsdaten sind und wie bei den bekannten Programmen daraus auch ein Fehler, das sogenannte bias, entstehen kann, den es gilt, mit kritischem Blick zu hinterfragen.
Denn dass die Künstliche Intelligenz letztendlich nicht intelligent ist, sondern vielmehr abhängig von der Intelligenz derer, die sie füttern oder später nutzen, das wurde auch hier noch einmal deutlich. So wundert es nicht, dass Dengel eine Schere voraussieht, die sich zwischen sehr klugen Schülerinnen und Schülern und weniger klugen auftun wird, und die sich zudem weiter und weiter öffnen wird, weil die einen die KI ideal nutzen werden und sie aufgrund ihrer eigenen Expertise geschickt ergänzend befragen können, während die anderen schnell mit den Ergebnissen zufrieden sein werden und diese unreflektiert verwenden, ohne selbst tiefer in die Materie einzusteigen.
Und was ist nun die gute Nachricht? Es gibt gleich mehrere. Denn umgekehrt kann man mittels KI auch viel individueller auf die Lernbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen eingehen, wenn man die entsprechenden Programme kennt und nutzt. Die eKIdz-APP zum Beispiel, die entsprechend der individuellen Lesekompetenz Trainingsangebote liefert, wäre eins von mehreren genannten Beispielen oder die Ikigai-APP (japanisch für Glück), die Dengel entwickelte, um die Interessen von Lernenden zur Grundlage des Lernens zu machen. Wer derart individualisiert seinen Lernbedürfnissen folgen kann, erlebt sich wirksam und dies macht am Ende glücklich, oder nicht?
Constanze Schneider