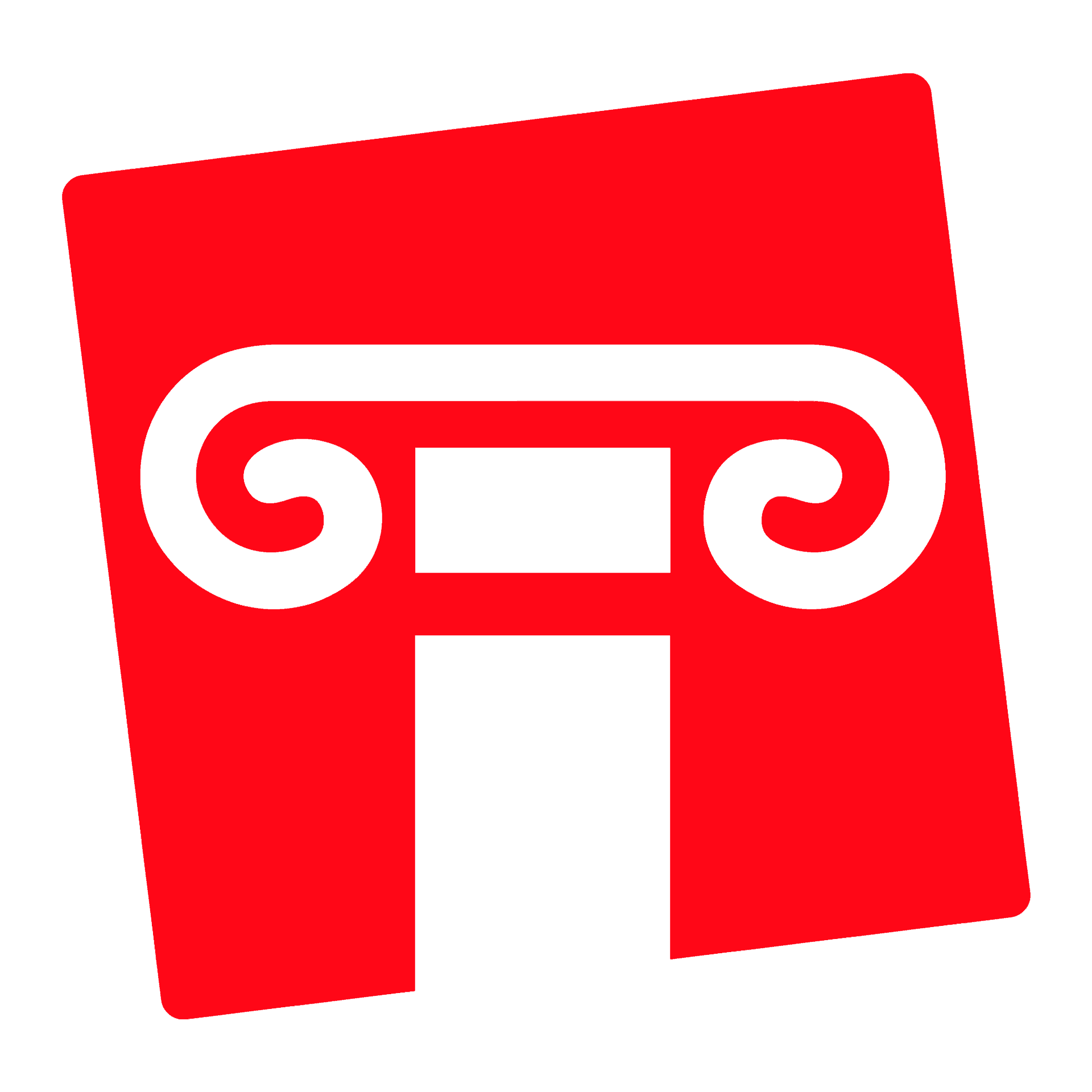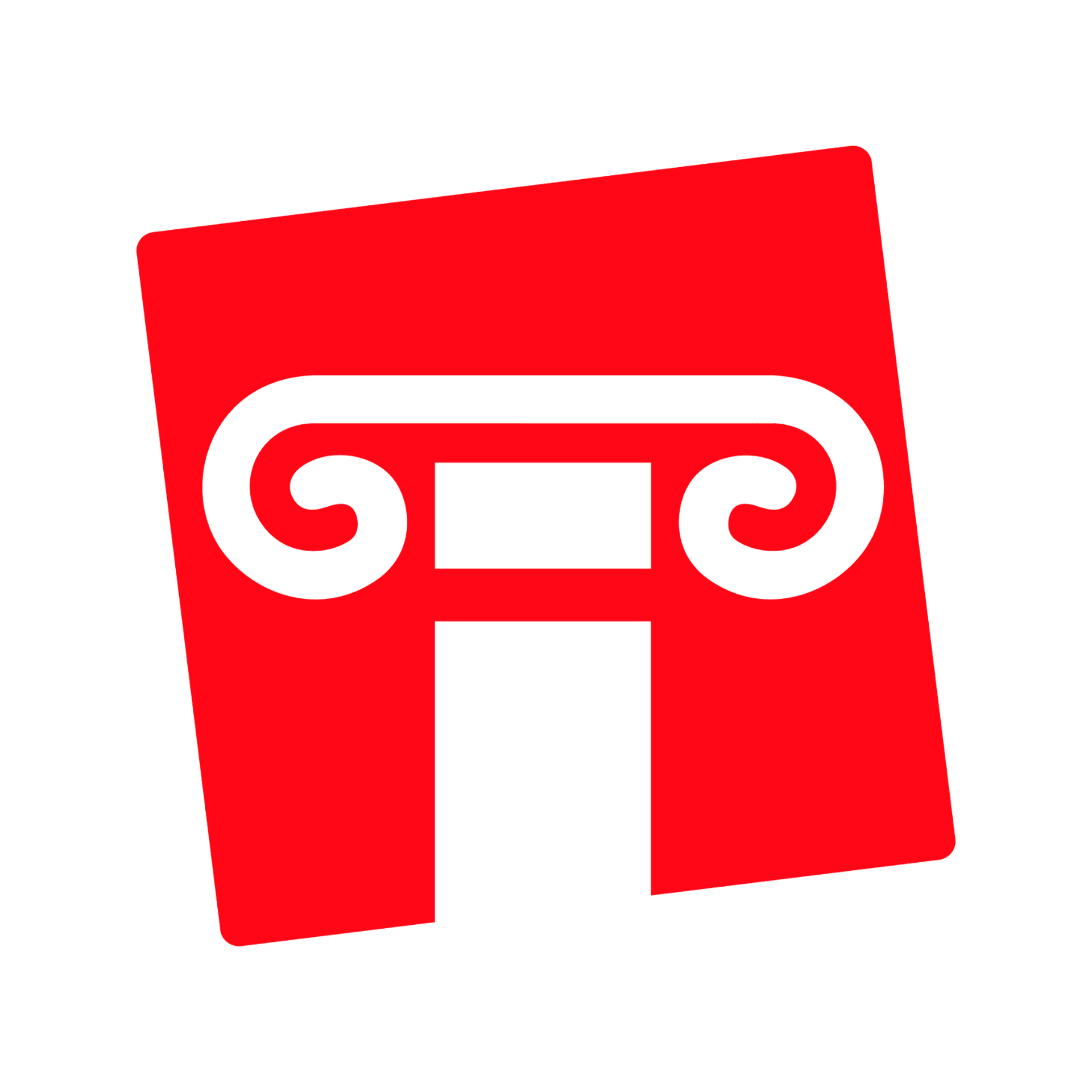10.12.2014 | Hundert Jahre ist es nun her, dass der Erste Weltkrieg ausbrach; ein Grund auch für unsere Schule sich mit dieser „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ (G. F. Kennan) zu beschäftigen.
Feinde wie wir
Jugend auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges
In seinem Feldpostbrief vom 12. September 1916 schreibt der damals 19jährige Student F. G. Steinbrecher: „Somme – die Welt hat wohl kein grauenvolleres Wort. … Durch zerschossenen Wald vor im Granatenhagel. Ich weiß nicht, wie ich den rechten Weg fand. Dann in eine Ebene von Granattrichtern, breitwerdend, immer vorwärts. Fallen und wieder aufstehen. Maschinengewehre schossen. Feindliches und eigenes Sperrfeuer habe ich durchquert. Ich bin heil. Endlich voran. Franzosen dringen ein. Hin und her wogt der Kampf. Dann wird’s ruhiger. Wir sind keinen Fuß breit gewichen. Jetzt erst sieht das Auge. Ich will immer vorwärts rennen; stillhalten und sehen ist furchtbar. Ein Wall von Leichen und Verwundeten.“
Gerade von der Jugend wurde im Ersten Weltkrieg heroischer Patriotismus erwartet und die Schrecken des Krieges wurden bagatellisiert und auch verschwiegen. Nach dem Zweiten Weltkrieg leben wir zum Glück heute in einem Land, das seit mehr als siebzig Jahren keinen Krieg erfahren hat. Um so wichtiger ist es, dass auch die heutige Jugend lernt, was Krieg bedeutet: Tod und Zerstörung.
Mit diesem pädagogischen Ziel kam auch der Rundfunkautor Herr Helmut Kopetzky am 26.11.2014 in unsere Schule, wo er sich und sein Radio-Feature „Feinde wie wir – Jugend auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges“ den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 9 vorstellte. Für Herrn Kopetzky war der Erste Weltkrieg ein Krieg der Jugend und so sollten gerade ihre Erfahrungen bei seinem Feature im Vordergrund stehen. Dabei ging es ihm nicht nur um die deutsche Sicht auf diesen Krieg, sondern vielmehr um die internationale Betrachtung. Schließlich seien in allen Ländern junge Menschen in den Krieg gezogen. Herr Kopetzky meint dazu, dass die alle wie betrunken waren, wurde ihre Kriegsbegeisterung doch unter anderem von der Gesellschaft, der Kirche und auch den Schulen geschürt. Hier nun schlägt Herr Kopetzky die Brücke zur Gegenwart: Auch heute seien junge Menschen, auch in Deutschland, wieder kriegsbegeistert. Herr Kopetzky nannte als Beispiel vor allem den IS-Terror, dessen Propaganda auch in Deutschland junge Menschen verführt. Das „Einpeitschen“ ist zwar heute subtiler als vor hundert Jahren, aber auch weniger überschaubar. Das Internet spielt hierbei eine große Rolle. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Herr Kopetzky dies nicht mehr für möglich gehalten. Die Nachkriegsjugend hätte vielmehr nach dem Motto gehandelt: „Nie wieder!“ Es ist daher erschreckend, dass unsere Sprache (z.B. in den Medien) zunehmend kriegerisch werde. Zu schnell und zu leichtfertig werde heute von Krieg gesprochen, was früher Konflikte waren, meint Herr Kopetzky. Man gewöhne sich eben wieder an den Krieg.
Der Radio-Journalist erzählte auch aus seinem eigenen Leben. Geboren wurde Herr Kopetzky 1940 in Mährisch-Schönberg, in der heutigen Tschechischen Republik. Der Vater fiel früh im Zweiten Weltkrieg und auch der Stiefvater kehrte aus dem Krieg nicht nach Hause zurück. Schicksalsschläge, die die Familie verkraften musste und schwer belastete. Seine Mutter hat viel leisten müssen, sagt Herr Kopetzky zu den Schülerinnen und Schülern im Filmraum, wie so viele Frauen damals, die Herr Kopetzky als „eisern“ beschreibt. 1946 erfolgte schließlich die Aussiedlung nach Fulda, wo er auch das Abitur machte.
Als Radio-Journalist konfrontierte Herr Kopetzky unsere Schülerinnen und Schüler mit einem Medium, das aus einer anderen Zeit stammt. Er selbst kenne noch die Zeit, in der nicht jeder einen Fernseher hatte und das Radio einen stärkeren Raum im Alltag einnahm. Für unsere heutige Medienlandschaft ist es ungewohnt, dass man nur hört und eben keine Bilder präsentiert bekommt. Aber, so meinte Herr Kopetzky, es gibt natürlich Bilder, die aufgrund des Gehörten im Kopf entstehen. Da aber eine solche Konzentration auf das Hören auch anstrengend ist, teilte Herr Kopetzky sein Feature in drei Teile ein.
Der erste Abschnitt des Features beginnt mit der künstlich erzeugten Kriegs-Begeisterung im August 1914. Überall finden wir diese Kriegsbegeisterung, die mit „Hurra“ in den Krieg zieht, nicht nur in Deutschland, sondern auch in England, in Russland, in Serbien und überall sonst. Voller Enthusiasmus meldeten sich die Freiwilligen – häufig auch junge Leute, frisch aus der Schule –, um das Fronterlebnis bloß nicht zu verpassen. Herr Kopetzky konnte aufgrund früherer Recherchen auf viele Originalaufnahmen von Kriegsteilnehmern aus vielen europäischen Ländern zurückgreifen. In seinem Feature sagt dann auch ein Zeitzeuge, dass es damals keinem in den Sinn gekommen wäre, nicht am Krieg teilzunehmen. Geradezu unbekümmert gingen die jungen Menschen in den Krieg, an dessen Teilnahme sie selbstverständlich nicht zweifelten. Im Durchschnitt waren die jungen Leute 18 Jahre, viele auch jünger. Die meisten dachten, dass es nur ein „Spaziergang“ sei und sie zu Weihnachten wieder zu Hause wären. Vermutlich glaubte auch der Kaiser Wilhelm II. an einen kurzen Krieg, doch das war ein Irrtum, der vier Jahre dauern sollte. Der Tod auf dem Schlachtfeld wurde als ehrenvoll und heldenhaft verklärt. So liest man denn auch im Feldpostbrief des Studenten W. Weidemann (6. Juli 1915): „Mag sein Leib unerkannt in fremder Erde ruhen, er hat den schönsten Tod erlitten.“ Dass dies mit der Realität wenig zu tun hatte, zeigt der zweite Teil des Features. Hier werden eindrücklich der Alltag und der Schrecken der Soldaten im Kriegsgewirr geschildert. Die von Herrn Kopetzky Interviewten berichten von den qualvollsten Arten zu sterben, von schrecklichen Verletzungen und Verstümmelungen. Im Feature erzählt ein ehemaliger Kriegsteilnehmer davon, wie ein deutscher Hauptmann aus dem Schützengraben stürmt – im Auge das Monokel, die Zigarre zwischen den Lippen und mit gezücktem Degen gegen das Maschinengewehrfeuer. Der Tod ereilte ihn schnell, anders als den jungen Mann, dem Teile des Gesichts von einer Granate zerfetzt wurden. So mancher Schülerin und manchem Schüler konnte man bei diesen Berichten ein Schaudern im Gesicht ablesen.
Geführt wurde dieser Erste Weltkrieg noch wie ein Krieg aus dem 19. Jahrhundert, aber mit den neuen technischen Entwicklungen war es bereits ein moderner Krieg. Die Soldaten stürmten nach Vorne, oder wurden getrieben, in den sicheren Tod. Viele Schlachtfelder zeugen von dem sinnlosen Sterben der jungen Menschen: Langemark, Verdun, Gallipoli, … Ob sie nun Deutsche, Franzosen, Engländer oder Australier waren, überall erlebten die Soldaten das Gleiche. Und am Ende wussten sie noch nicht einmal, weshalb sie den Krieg führten.
Der dritte Teil des Features von Herrn Kopetzky unterschied sich von diesen unmittelbaren Eindrücken zuvor. Gedanklich wurde ein Sprung in die Zeit des Dritten Reichs unternommen und wir hörten Originalaufnahmen eines sogenannten „Langemarck-Gedenktages“ (die Deutschen schrieben Langemark mit „ck“, da es härter klingt), denn von den Nazis wurde der Opfergedanke zelebriert; sollten sich doch die Menschen für die NS-Ideologie ebenso opfern. Erzeugt wurde ein Opferkult, der auch im Zweiten Weltkrieg zu unermesslichem Leiden führte.
Nach der Veranstaltung stand Herr Kopetzky noch für Fragen zur Verfügung. Die erste Frage war, was ihn bei seinen Recherchen am Meisten beeindruckt habe. Der Radio-Journalist antwortete, dass ihm vor allem der Irrsinn des Krieges bewegt habe, der am Deutlichsten im Langemarckmythos auftauche. In der Rezeption dieses Mythos heißt es, dass die jungen Soldaten (überwiegend Studenten) mit dem Deutschlandlied auf den Lippen gegen die feindlichen Stellungen angestürmt und den Heldentod gestorben seien. Herr Kopetzky bezweifelt jedoch den Wahrheitsgehalt dieses Mythos: Kein deutscher Soldat ist seinen Recherchen zu Folge mit dem Deutschlandlied auf den Lippen in die Schlacht gezogen. Keiner der interviewten Überlebenden konnte sich daran erinnern, und außerdem war es durch den aufgeweichten Boden viel zu anstrengend (30 kg Gepäck). Als weiteres Beispiel für den Irrsinn des Krieges ging Herr Kopetzky auf die Schlacht um Galipoli ein, weil hier ebenso rücksichtslos und menschenverachtend Soldaten geopfert wurden.
Ein Schüler fragte nach dem Aufwand eines solchen Features. Herr Kopetzky führte aus, dass die Erarbeitung eines solchen Features bis zu einem Jahr dauert und sehr umfangreiche Recherchen benötigt. Für dieses Feature konnte er zum Glück auf Material aus den 70ern und 80ern zurückgreifen, als noch viele der Zeitgenossen des Ersten Weltkriegs am Leben waren. Zum Abschluss erkundigte sich eine Schülerin danach, ob sich manche alte Kriegsteilnehmer auch einem Interview versagten. Herr Kopetzky führte aus, dass man natürlich nicht mit der Tür ins Haus fallen dürfe, sondern sehr viel Geduld und Feingefühl für solche Interviews aufbringen müsse.
Herr Kopetzky unterhielt uns mit seinem Feature etwa eine Stunde, in der wir ein vielfältiges Stimmengewirr der Soldaten hörten und ebenso häufig die Kriegsschauplätze wechselten. Das Ergebnis war eine beeindruckende Collage, die ein lebendiges Zeugnis und eine Mahnung zugleich darstellt.
StR Patrick Elm